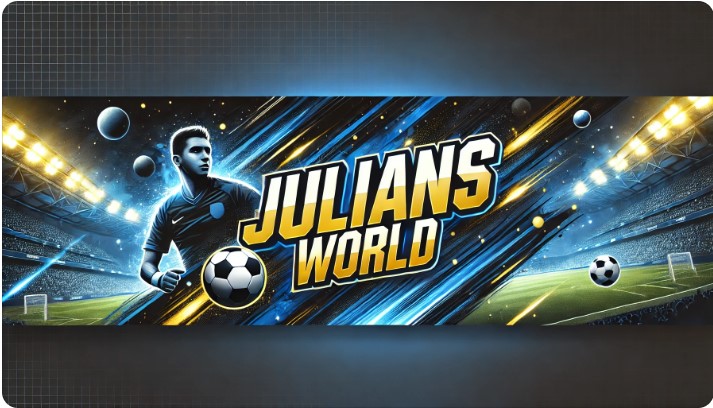Die fortschreitende Digitalisierung macht kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aus dem Baugewerbe zunehmend zum Ziel von Cyberangriffen. Laut einer Bitkom-Studie aus dem Sommer 2025 waren 87 Prozent der befragten Unternehmen innerhalb von zwölf Monaten von Datendiebstahl, Spionage oder Sabotage betroffen; der Gesamtschaden für die deutsche Wirtschaft wird auf rund 289,2 Milliarden Euro pro Jahr beziffert. Gleichzeitig zeigt der aktuelle Lagebericht des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), dass rund 80 Prozent der angezeigten Ransomware-Angriffe KMU treffen.
Die fortschreitende Digitalisierung macht kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aus dem Baugewerbe zunehmend zum Ziel von Cyberangriffen. Laut einer Bitkom-Studie aus dem Sommer 2025 waren 87 Prozent der befragten Unternehmen innerhalb von zwölf Monaten von Datendiebstahl, Spionage oder Sabotage betroffen; der Gesamtschaden für die deutsche Wirtschaft wird auf rund 289,2 Milliarden Euro pro Jahr beziffert. Gleichzeitig zeigt der aktuelle Lagebericht des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), dass rund 80 Prozent der angezeigten Ransomware-Angriffe KMU treffen.
Vor diesem Hintergrund warnen Fachleute: Ohne ein klares Umdenken und systematische Investitionen in IT-Sicherheit bleibt die Baubranche hochgradig verwundbar – mit potenziellen Schäden bis in den sechs- und siebenstelligen Bereich durch Betriebsunterbrechungen, Projektverzögerungen und Datenverluste.
Baugewerbe im Fokus von Cyberkriminellen
Der Bausektor galt lange als Domäne analoger Prozesse. Mit der Verbreitung von BIM-Anwendungen, Cloud-Diensten, vernetzten Maschinen sowie mobiles Arbeiten auf Baustellen hat sich dieses Bild grundlegend gewandelt.
Sicherheitsexperten beobachten seit einigen Jahren eine deutliche Zunahme gezielter Angriffe auf Unternehmen der Bau- und Immobilienwirtschaft. Besonders betroffen sind mittelständische Betriebe und Handwerksunternehmen, deren IT-Strukturen oft historisch gewachsen und nur teilweise professionell abgesichert sind.
Hinzu kommt die hohe Attraktivität der Branche für Industriespionage: Baupläne, Ausschreibungsunterlagen, Kalkulationen sowie sensible Informationen über Auftraggeber und Projekte besitzen einen erheblichen wirtschaftlichen Wert – für Konkurrenten ebenso wie für organisierte Kriminalität.
Quelle: Mittelstand Digital Zentrum WertNetzWerke
Hauptangriffsvektoren: Phishing und veraltete IT
Die grundlegenden Sicherheitsprobleme im Bau unterscheiden sich nicht wesentlich von anderen Branchen, sind dort aber häufig weniger adressiert. Fachleute benennen vor allem zwei zentrale Einfallstore:
-
Phishing und Social Engineering:
Gefälschte E-Mails, Links oder QR-Codes, die Mitarbeitende zum Öffnen von Schadsoftware oder zur Preisgabe von Zugangsdaten verleiten, gehören nach wie vor zu den häufigsten Einstiegsmethoden. -
Veraltete oder schlecht gewartete IT-Systeme:
Nicht eingespielte Sicherheitsupdates, abgekündigte Betriebssysteme oder unsichere Remote-Zugänge eröffnen Angreifern direkte Angriffspunkte auf Unternehmensnetzwerke.
Besonders kleinere Bau- und Handwerksbetriebe geraten hier unter Druck: Sie arbeiten häufig parallel mit einem älteren Bürorechner, einer Vielzahl von Smartphones und Tablets auf der Baustelle und einzelnen Cloud-Lösungen – ohne übergreifendes Sicherheitskonzept. Fehlende personelle Ressourcen und hoher Zeitdruck im Tagesgeschäft verstärken diese Situation.
Cloud, eigene Server – und die Rolle der KI
Ein weiteres zentrales Thema ist die Frage nach der richtigen Infrastruktur. Fachleute raten dazu, die Vor- und Nachteile von Cloud-Lösungen und eigenen Servern sorgfältig abzuwägen:
-
Cloud-Dienste bieten den Vorteil, dass Updates, Patches und Basis-Sicherheit in der Verantwortung professioneller Betreiber liegen. Gleichzeitig werden zentrale Plattformen mit großen Datenmengen zu besonders attraktiven Angriffszielen, und die Datenhoheit liegt nicht mehr vollständig im Unternehmen.
-
Eigene Server und redundante Systeme ermöglichen maximale Kontrolle über sensible Projekt- und Kundendaten, erfordern aber entsprechendes Know-how, klare Prozesse und ausreichende personelle Ressourcen im Unternehmen.
Eine wachsende Rolle spielt dabei die Künstliche Intelligenz (KI):
Auf der Verteidigungsseite können KI-gestützte Systeme Auffälligkeiten und neue Angriffsmuster schneller erkennen als klassische Virenscanner. Gleichzeitig nutzen Cyberkriminelle KI, um täuschend echte Phishing-Mails zu erstellen, automatisiert Schwachstellen zu scannen und ihre Angriffswerkzeuge laufend anzupassen. Die technologische Aufrüstung findet somit auf beiden Seiten statt.
Bauprojekte als komplexe Angriffsfläche: Lieferketten im Blick
Typisch für die Baubranche ist die stark vernetzte Projektstruktur: Planung, Generalunternehmer, Nachunternehmer, Hersteller, Logistik und Betreiber arbeiten über verschiedene Plattformen und IT-Systeme zusammen.
Jedes dieser Glieder in der Lieferkette kann im schlimmsten Fall zum Sicherheitsrisiko werden, wenn grundlegende Anforderungen an IT-Sicherheit nicht erfüllt sind. Kompromittierte Zugangsdaten oder infizierte Dateien können sich entlang der gesamten Kette ausbreiten – bis hin zur Manipulation von Planungsständen, Terminplänen oder sensiblen BIM-Modellen.
Struktur statt Einzellösungen: Normen und Unterstützungsangebote
Eine einfache „TÜV-Plakette“ für IT-Sicherheit gibt es nicht. Sicherheitsexperten empfehlen deshalb, das Thema systematisch zu verankern:
-
Informationssicherheits-Management (ISMS):
Ein ISMS schafft klare Prozesse und Zuständigkeiten für Informationssicherheit – von der Risikoanalyse über technische Maßnahmen bis hin zu Notfallplänen. -
DIN SPEC 27076 – Einstieg für kleine Unternehmen:
Die DIN SPEC 27076 bietet speziell für kleine und Kleinstunternehmen einen strukturierten Fragenkatalog, um das eigene Sicherheitsniveau einzuschätzen und prioritäre Maßnahmen abzuleiten. Auf dieser Basis wurde etwa der „CyberRisikoCheck“ entwickelt, der Unternehmen eine standardisierte Erstbewertung ihrer IT-Sicherheit ermöglicht. -
Öffentliche Unterstützungsangebote:
Initiativen wie die Transferstelle Cybersicherheit in der Wirtschaft oder die Allianz für Cybersicherheit beim BSI stellen praxisnahe Informationen, Leitfäden und Schulungsangebote bereit – mit besonderem Fokus auf KMU.
Konkrete Handlungsfelder für Bau-KMU
Für Unternehmen aus dem Baugewerbe lassen sich daraus zentrale Handlungsfelder ableiten:
-
Sicherheits-Basics etablieren
-
Regelmäßige Updates und Patches
-
Starke Passwörter und Mehr-Faktor-Authentifizierung
-
Verlässliche Backup-Strategie mit offline bzw. unveränderbaren Sicherungskopien
-
-
Mitarbeitende sensibilisieren
-
Wiederkehrende Schulungen zu Phishing, Umgang mit mobilen Geräten und Schutz sensibler Projektdaten
-
Klare Meldewege bei verdächtigen E-Mails und Vorkommnissen
-
-
Verantwortung und Prozesse klären
-
Benennung von verantwortlichen Personen für IT- und Informationssicherheit
-
Einführung eines einfachen ISMS oder Nutzung der DIN SPEC 27076 als Einstieg
-
Erarbeitung und regelmäßige Aktualisierung von Notfall- und Wiederanlaufplänen
-
-
Lieferkette einbinden
-
Mindestanforderungen an IT-Sicherheit in Verträgen mit Nachunternehmern und Dienstleistern
-
Nutzung sicherer Datenräume und Plattformen für gemeinsame Projektarbeit
-
-
Strategische Entscheidungen zur Infrastruktur treffen
-
Bewusste Entscheidung zwischen Cloud- und On-Premises-Lösungen – ggf. kombiniert
-
Klassifizierung von Daten (welche Informationen dürfen in die Cloud, welche bleiben im eigenen Rechenzentrum?)
-
Fazit: Digitale Resilienz wird zum Wettbewerbsfaktor
Die Zahlen aus Bitkom-Studie und BSI-Lagebericht zeigen eindeutig: Cyberangriffe sind längst kein Randphänomen mehr, sondern ein strukturelles Risiko – gerade für kleine und mittlere Unternehmen. Für das Baugewerbe, das sich mitten in der digitalen Transformation befindet, wird digitale Resilienz damit zu einem zentralen Wettbewerbsfaktor.
Wer jetzt in IT-Sicherheit, klare Prozesse und die Qualifizierung seiner Mitarbeitenden investiert, reduziert nicht nur das Risiko existenzbedrohender Schäden, sondern stärkt auch die eigene Position in zunehmend digitalisierten Wertschöpfungsketten – von der Planung bis zum fertigen Bauwerk.